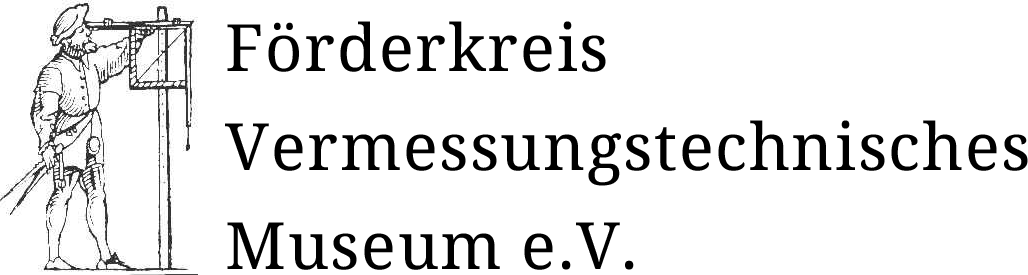Historische Grenzsteine entlang der sächsisch-tschechischen Grenze
Staatsgrenzen wurden über die Jahrhunderte durch unübersehbare Grenzsteine aller Art dauerhaft markiert. Die ehemaligen Herrscher haben bis heute ihre Spuren an ihren Herrschaftsgrenzen hinterlassen (siehe Mitt. Nr. 631). Solche historischen Grenzmarkierungen sind auch heute noch in der Örtlichkeit anzutreffen. Die Autoren Pavel Hánek jun., Harald Weber und Pavel Hánek sen. haben nun im VDVmagazin 1(2025) einen hochinteressanten, reich bebilderten Artikel über “Vermessungsdenkmale entlang der sächsisch-tschechischen Grenze – Historische Grenzzeichen” veröffentlicht.
Nach einem Rückblick in antike Grenzvermarkungen schildern sie die historische Entwicklung des politischen Grenzverlaufs zwischen Böhmen und Sachsen vom 10. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Sie erörtern die Änderungen und Festlegungen der Grenze durch mehrere Grenzverträge, zunächst zwischen dem Herzogtum Böhmen und der Markgrafschaft Meißen 1372, später zwischen dem Königreich Böhmen und dem Kurfürstentum Sachsen 1459 und die Neuvermarkung zwischen dem Königreich Böhmen und dem Königreich Sachsen in den Jahren 1845/48, hierzu entstanden erstmals Grenzkarten und Grenzbeschreibungen. Der seit 1994 gültige Grenzvertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland behandelt einen 459 Kilometer langen Grenzverlauf, davon 185 Kilometer als sogenannte Nassgrenze in Wasserläufen. (VDVmagazin 1/2025, S. 18-24)
Der für Vermessungshistoriker und Heimatforscher gleichermaßen wertvolle Beitrag im 2. Teil behandelt die historischen Vermarkungen der trigonometrischen Punkte. Im Verlauf der von Generalleiutnant Johann Jacob Baeyer (1794-1885) 1862 initiierten europäischen Gradmessung, der Sächsischen Triangulation1862-1890 sowie der Tschechischen Triangulation 1862-1873 wurden beiderseits der Staatsgrenze zahlreiche TP I. Ordnung dauerhaft mit bis zu 4 Meter hohen Steinpfeilern vermarkt. Die Leitung der sächsischen Triangulationsarbeiten hatte Professor Christian August Nagel (1821-1903); er war Direktor des Geodätischen Instituts der Polytechnischen Hochschule in Dresden. An diesen Arbeiten war Nagels Schüler Friedrich Robert Helmert (1843-1917) als berufener "Gradmessungsassistent beteiligt. das österreichisch-böhmische Netz bearbeitete das Militärgeographische Institut (MGI) Wien; deren Vermarkungen bestanden überwiegend aus rund ein Meter hohen Steinsäulen.
Das sächsische Netz umfasste auch 11 Stationen auf dem österreichisch-tschechischen Gebiet, die teilweise in das trigonometrische Netz des Königreichs Böhmen übernommen wurden. Diese sogenannten "Nagelschen Säulen" sind großenteils bis heute erhalten geblieben; neben den Säulen stehen oftmals Gedenktafeln oder Informationstafeln zu ihrer Vermessungsgeschichte. Dazu gehören u.a. die Stationspunkte Jeschken/Jested, Schneeberg/Dêcinský Snêznik), Aschberg/Kamenak und Großenstein (Eduardsstein)/Eduadûv kámen. Diese gut erhaltenen trigonometrischen Punkte laden zu einem vermessungshistorischen Besuch ein. (VDVmagazin 2/2025, S. 106-110)